Wie geht Auferstehung?
Ein Gespräch mit der Theologin Angela Wäffler-Boveland über Bilder von Auferstehung, prophetische Visionen, die Bedeutung der Psalmen und warum das Aufstehen zum Leben jetzt schon beginnen kann.
Die Ostergeschichte kennen wir aus dem Neuen Testament. Die Hoffnung auf Auferstehung hat ihren Ursprung aber schon im Alten Testament. Wo findet man sie?
Jesus und seine ersten Jüngerinnen und Jünger waren jüdisch vom Tanach (unserem Alten Testament) geprägt. Was immer sie taten und erlebten, deuteten sie vor dem Hintergrund ihrer Heiligen Schrift. Und sie fanden dort vieles, was sich auf Jesu Wirken, Sterben und Auferstehen anwenden liess.
Jesus hat – so berichten die Evangelien – viele Menschen aufgerichtet und sie damit wieder ins soziale Leben integriert. Er hat geheilt und aufgeweckt für ein volles Leben in Gemeinschaft. Dabei unterscheiden weder die hebräische noch die griechische Sprache zwischen «aufstehen» und «auferstehen» oder «aufwecken» und «auferwecken».
Was heisst denn aufgeweckt werden?
Wer aufgeweckt wird und aufsteht, wendet sich von der Nacht dem Tag zu, wird aus Krankheit gesund, aus Tod lebendig – und steht auf gegen Unrecht, Unterdrückung und Gewalt.
Wo zeigt sich das in der Bibel konkret?
Im Jesajabuch (Jes 26) wird diese Hoffnung so ausgedrückt: «Deine Toten aber werden leben, ihre Leichname stehen wieder auf.» Die alttestamentlichen Bilder von Auf(er)stehung haben stets eine sozialpolitische, befreiende Perspektive, erinnern an die Befreiung aus Sklaverei, auch wenn sie zunächst als individuelle, persönliche Rettung erscheinen.
In diesem Sinn berichten die Evangelien, dass Jesus Jairus Tochter (Mk 5), einen jungen Mann aus Nain (Lk 7) und seinen Freund Lazarus (Jh 11) aus dem Tod weckt – ganz nach dem Vorbild von Elija, der den Sohn einer Witwe aus Zarefat aus dem Tod weckt (1Kön 17). Es fällt auf, dass es sich bei allen Aufgeweckten um junge Menschen handelt, die ein ganzes Leben vor sich haben.
Welche Symbole im Alten Testament weisen auf den Glauben an ein Leben nach dem Tod hin?
Das wohl wichtigste Symbol ist die Befreiung aus ägyptischer Sklaverei, die wie ein kollektiver Zustand des Todes verstanden worden ist. Die Erinnerung daran zieht sich als roter Faden durch das ganze Alte Testament. «Tod» erscheint hier als soziale Dimension, aus der Einzelne wie ein ganzes Volk geweckt werden, um für das Leben aufzustehen.
Auch der bekannte Psalm 23 enthält eine subtile Auferstehungsperspektive: Im Vers 6 heisst es: «und ich werde zurückkehren in Gottes Haus». Gottes Haus ist das Haus des Lebens. Das muss nicht transzendent verstanden werden, sondern kann ganz irdisch gemeint sein. Zumal das hebräische Wort auch «bleiben» bedeuten kann.
Entscheidend ist, dass im Bleiben wie im Zurückkehren Leben möglich ist. Daran erinnert Jesu Gleichnis vom Vater mit den zwei verlorenen Söhnen (Lk 15): Der eine geht fort und kehrt zurück, der andere bleibt da – doch beide müssen das Leben in Fülle erst wieder entdecken.
Von welcher Erwartungshaltung ist Jesaja getragen, wenn er voraussagt, dass keine Kinder mehr sterben und kein Weinen mehr zu hören sein wird?
Am Ende des Jesajabuches findet sich eine wunderbare Friedensvision, in der ausgemalt wird, wie Leben idealerweise sein könnte: eine Welt ohne Kindersterblichkeit und mit hoher Lebenserwartung, ohne Trauer und Angst, Gewalt und Vernichtung.
Diese Vision hat nicht direkt mit Auferstehung aus dem Tod zu tun, sondern entfaltet eine andere Weltordnung im Sinne Gottes. Was Jesaja sich als Bild für «einen neuen Himmel und eine neue Erde» ausmalt, bleibt noch immer Zukunftsmusik. Eine Vision ist keine Voraussage, sondern eine Hoffnung, die in der Beziehung zwischen Gott und Menschen begründet ist. Es ist die Verheissung, dass das Himmelreich Gottes auf Erden möglich sein könnte.
Hat auch die berühmte Geschichte von Jona und dem Wal etwas mit Auferstehung zu tun?
Im Matthäus-Evangelium wird auf das «Zeichen des Jona» verwiesen: «Denn wie Jona im Bauch des Fisches war, drei Tage und drei Nächte, so wird der Menschensohn im Schoss der Erde sein, drei Tage und drei Nächte.» Doch Jona ist eigentlich ein Antiheld, der – anders als Jesus – seinen Weg nicht bewusst und willentlich geht, sondern immer wieder gegen Gott rebelliert.
Die Novelle erzählt, dass es keinen Sinn macht, vor Gott davonlaufen zu wollen, dass Menschen sich ändern können und Gott sich mit ihnen ändert. Gott bewahrt auch hier vor dem Untergang – nicht nur Jona, sondern besonders die Lebensgemeinschaft der Stadt Ninive. Und da Ninive die Hauptstadt des feindlichen Assur ist, gilt diese Lebenszusage nicht nur dem jüdischen Volk, sondern der ganzen Welt. Diesen weltumspannenden Horizont hat auch die Auferstehung Jesu.
Wie können solche Verweise unsere Auffassung von Ostern bereichern?
Ostern kann vom Alten Testament her als soziale, als gemeinsame Perspektive verstanden werden, wo Menschen sich aus politischen Machtbereichen befreit sehen und von Gott her Leben in Fülle für alle erwarten und entwickeln.
Die Hoffnung auf persönliche irdische und eschatologische Auferstehung in dieser und in jener Welt könnte uns stark machen zum Widerstand gegen Unrecht, Gewalt und Unterdrückung; könnte uns aufmerksam machen für die kleine und grössere «Auferstehung mitten am Tag», wie Marie Luise Kaschnitz es formuliert hat.
Es geht dabei eigentlich nicht um die Einmaligkeit der Auferstehung Jesu, die wir zu Ostern feiern, sondern darum, dass Jesus «Erstling derer, die entschlafen sind», ist (1Kor 15,20), der uns im Aufstehen zum Leben vorangegangen ist. Dieses Vertrauen könnte uns grosszügiger, mitmenschlicher, mitgeschöpflicher machen, damit das Aufstehen zum Leben schon jetzt beginnen kann und das Reich Gottes in dieser Welt wirklich wird.
Angela Wäffler-Boveland ist Pfarrerin, ehemalige Leiterin von «Fokus Theologie». Der Text ist ein Ausschnitt aus einem längeren Interview im April-notabene. Interview: Madeleine Stäubli-Roduner
Zurück im Leben
Auch die Geschichte von Jona und dem Wal erzählt von Auferstehung.
Die Bibel selber entdecken
Die Geschichten und Gleichnisse der Bibel ermutigen, trösten und begleiten Christinnen und Christen auf der ganzen Welt. Sie sind seit Jahrhunderten Grundlage des Glaubens und inspirieren Menschen immer wieder neu. Uns ist es ein Anliegen, allen Menschen Zugang zu diesen Texten zu ermöglichen.
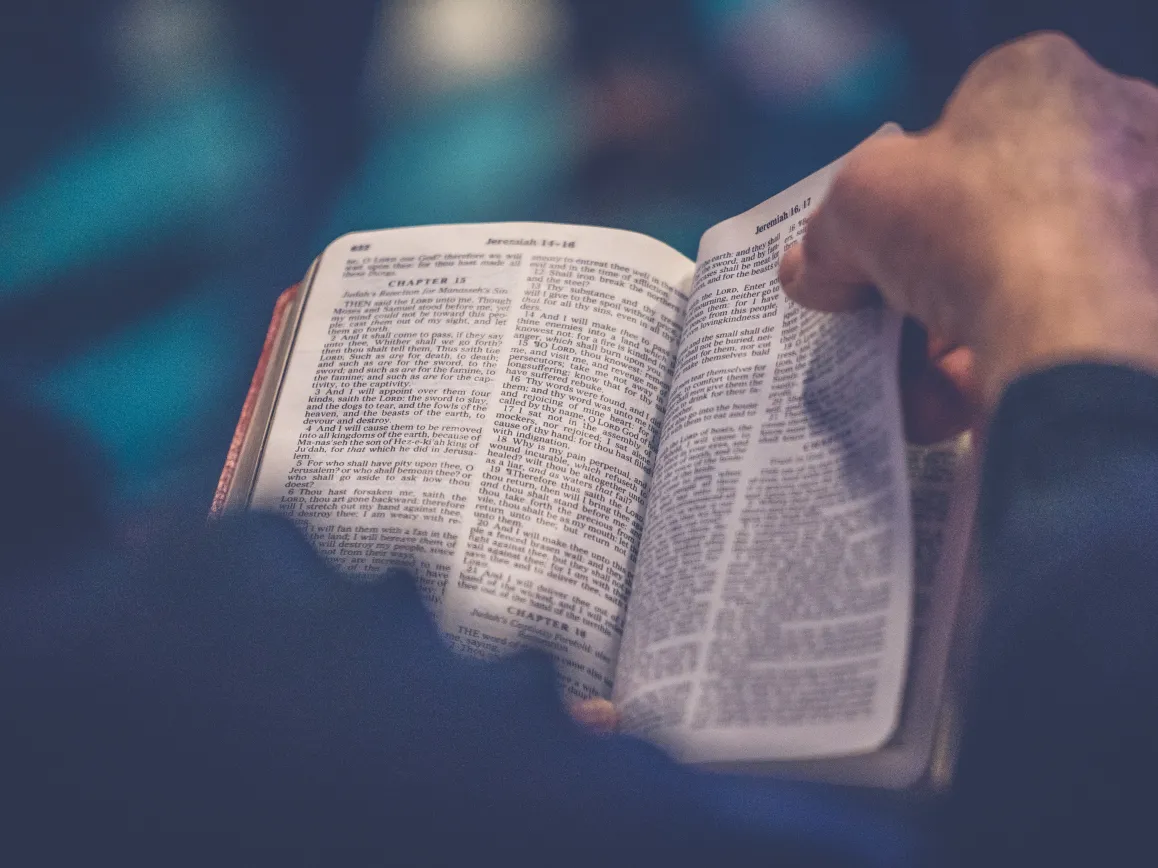
Theologisch tief schürfen
Menschen fragen nach Gott, sie wollen ihren Glauben besser verstehen oder über den Sinn des Lebens nachdenken. «Fokus Theologie» – so heisst die Fachstelle für theologische Erwachsenenbildung der Reformierten Kirchen, unterstützt die Menschen in diesem Suchen

