Glauben ist Chefsache – ein Konzil macht Geschichte
Vor 1700 Jahren brachten ein heidnischer Kaiser und 300 Bischöfe auf den Punkt, was Christen zu glauben haben. Die wundersame Geschichte des Konzils von Nicäa und die Frage, ob das Bekenntnis von damals uns heute noch etwas angeht.
Nach hitzigen Debatten und kühlen Vermittlungsversuchen, nach Wochen des Feilens an Formulierungen auf der Sommerresidenz des römischen Kaisers Konstantin ist es im Juli 325 endlich so weit: Ein einheitlicher Termin zur Feier des Osterfestes (am Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling) ist gefasst.
Und fast alle der 300 versammelten Bischöfe signieren ein Dokument, das ein für alle Mal festlegt, wie man die Beziehung von Gott und Jesus Christus – nämlich als Wesenseinheit – zu verstehen hat. Nur ein gewisser Arius aus Alexandria und zwei weitere Vertreter der ägyptischen Kirche scheren punktuell aus und werden deshalb kurzerhand verbannt.
Damit ist erreicht, was Kaiser Konstantin sich sehnlich gewünscht hat: dass sich die in seinem Reich ansässigen Christen in den Grundfragen des Glaubens einig sind. Das kaiserliche Motiv ist dabei klar: Die Einigkeit innerhalb der sich immer stärker etablierenden christlichen Religion dient der Stärkung der politischen Einheit des Reiches und der kaiserlichen Macht.
Deshalb hatte Konstantin sich für die Organisation des Konzils persönlich ins Zeug gelegt und dafür auch tief in die Schatulle gegriffen: Sämtliche Spesen für die Anreise zum Treffpunkt südlich des heutigen Istanbul wurden den bischöflichen Delegationen bezahlt, egal ob sie von der iberischen Halbinsel, von Nordafrika oder von der Schwarzmeerküste her anreisten.
Der Kaiser – selber noch nicht getauft – liess es sich nicht nehmen, das Theologentreffen persönlich zu moderieren und bei Bedarf zu intervenieren, damit es zu einer Einigung kam. Wie diese inhaltlich aussah, war für den Kaiser sekundär.
Allianz mit Nebenwirkungen
Die Folgen dieser Übereinkunft zwischen den wichtigsten Kirchenvertretern und dem Kaiser sollten immens und in der Welt- und Kirchengeschichte unfassbar nachhaltig sein: Kirche und Kaiser, Christentum und Politik gehen von da an während Jahrhunderten und teilweise bis in unsere Gegenwart Hand in Hand oder zumindest Seite an Seite.
Der Beginn dieser nicht immer konfliktfreien, aber dauerhaften Allianz, die man später Konstantinische Wende nennen wird, hinterlässt gewaltige Spuren im Christentum und bereitet den Boden für dessen flächendeckende Verbreitung im ganzen Reichsgebiet und in ganz Europa.
Kehrseite und Preis der staatlichen Umarmung der einst hart verfolgten christlichen Gemeinden: Die Kirche büsst phasenweise grosse Stücke ihrer Unabhängigkeit und Unbescholtenheit ein und läuft immer wieder Gefahr, zum Werkzeug der Mächtigen zu werden oder selber Machtpolitik zu betreiben.
Bis heute anerkannt
Neben dieser politischen Dimension markiert das Konzil von Nicäa auch einen theologischen Fixpunkt, an dem in der nachfolgenden Kirchengeschichte bis heute nicht mehr gerüttelt werden sollte: 1700 Jahre später beruft man sich unter den allermeisten christlichen Kirchen – auch den protestantischen – immer noch auf das damals gefasste Bekenntnis.
Es bilde bis heute die Grundlage für die ökumenische Zusammenarbeit, sagt die reformierte Theologin und Ökumene-Beauftragte der Zürcher Landeskirche, Bettina Lichtler. «Angesichts der vielfältigen Gotteserfahrungen, von denen in der Bibel berichtet werden und der vielen Interpretationsmöglichkeiten der biblischen Aussagen ist es für das ökumenische Zusammenarbeiten wichtig, einen gemeinsamen Deutungsrahmen zu haben.»
Diese Funktion erfülle das Bekenntnis von Nicäa aufgrund seiner breiten Anerkennung am besten, auch wenn es nicht so zugänglich sei wie das später gefasste und in Westkirchen häufiger verwendete Apostolische Glaubensbekenntnis.
Wer genau ist Jesus?
Die Sperrigkeit des nicänischen Bekenntnisses hängt mit der Herausforderung jener Zeit zusammen, die christlichen Glaubensaussagen auch in Begriffen der griechischen Philosophie auszudrücken, die den intellektuellen Standard der damaligen Zeit darstellte. Es ging dabei um die knifflige Frage, wie die Göttlichkeit von Jesus Christus zu verstehen sei, ohne den Glaubensgrundsatz in Frage zu stellen, dass es nur einen Gott gibt.
Die Göttlichkeit von Jesus Christus stand dabei für alle Konzilsteilnehmer ausser Frage. Nur, ob der Gottessohn als ewige Wesenseinheit mit dem einen Gott zu verstehen sei, oder doch eher als dessen nachgeordnete Schöpfung, sorgte unter den damaligen Glaubensexperten für rote Köpfe. Erstere Auslegung setzte sich erst nach wochenlangen Verhandlungen, dann aber deutlich und nachhaltig durch.
Problem gelöst. Aber verstanden?
Leicht zu vermitteln sei diese Klärung der Frage nach dem Wesen von Jesus in der Tat nicht, räumt Bettina Lichtler ein. Wegweisend und essenziell für den christlichen Glauben sei sie aber unbedingt: «Mich beeindruckt, wie man in Nicäa darum gerungen hat, Jesus Christus so zu verstehen und philosophisch zu fassen, dass er alles, wirklich alles zum Guten verändern kann.»
Die Voraussetzungen für dieses Glaubensverständnis lägen in der Festlegung auf der Wesenseinheit von Gott und Jesus Christus, erklärt die Pfarrerin und Fachfrau für Ökumene. «In den Aussagen über Jesus Christus betont das nicänische Bekenntnis in einer philosophischen Sprache, dass in ihm Gott ganz und gar Mensch geworden ist. In Jesus Christus als Sohn ist Gott genauso umfassend gegenwärtig, wie er es als Schöpfer und Allmächtiger, also als Vater ist.»
Kein Schlupfloch für die Sünde
Diese Festlegung sei im Hinblick auf die Erlösung zentral, sagt die Theologin: «Damit der Tod und die Auferstehung des Sohnes die Erlösung der Menschen bewirken konnten, musste in Jesus die ganze, umfassende Macht Gottes gegenwärtig sein.» Und genauso entscheidend: «Dass in Jesus die ganze Menschlichkeit durch alles Tödliche hindurchgeht in die Auferstehung und ins neue Leben.»
Das seit 1700 Jahren gültige Bekenntnis formuliere das Erlösungswerk also in der Weise, dass kein Schlupfloch «im Sinne von ‹etwas weniger Gott als der Vater› oder ‹etwas weniger Mensch als alle anderen Menschen› übrigbleibt, in das die Sünde als Spaltpilz zwischen Gott und Mensch wieder hätte hineinkriechen können».
Text: Christian Schenk
Feiern & eintauchen
Das Konzil feiern: Anlässlich des Jubiläums findet am 1. Juni im Berner Münster eine ökumenische Vesper statt.
Eintauchen in die Geschichte des Konzils – mit einer Film-Doku von «Arte» auf youtube.
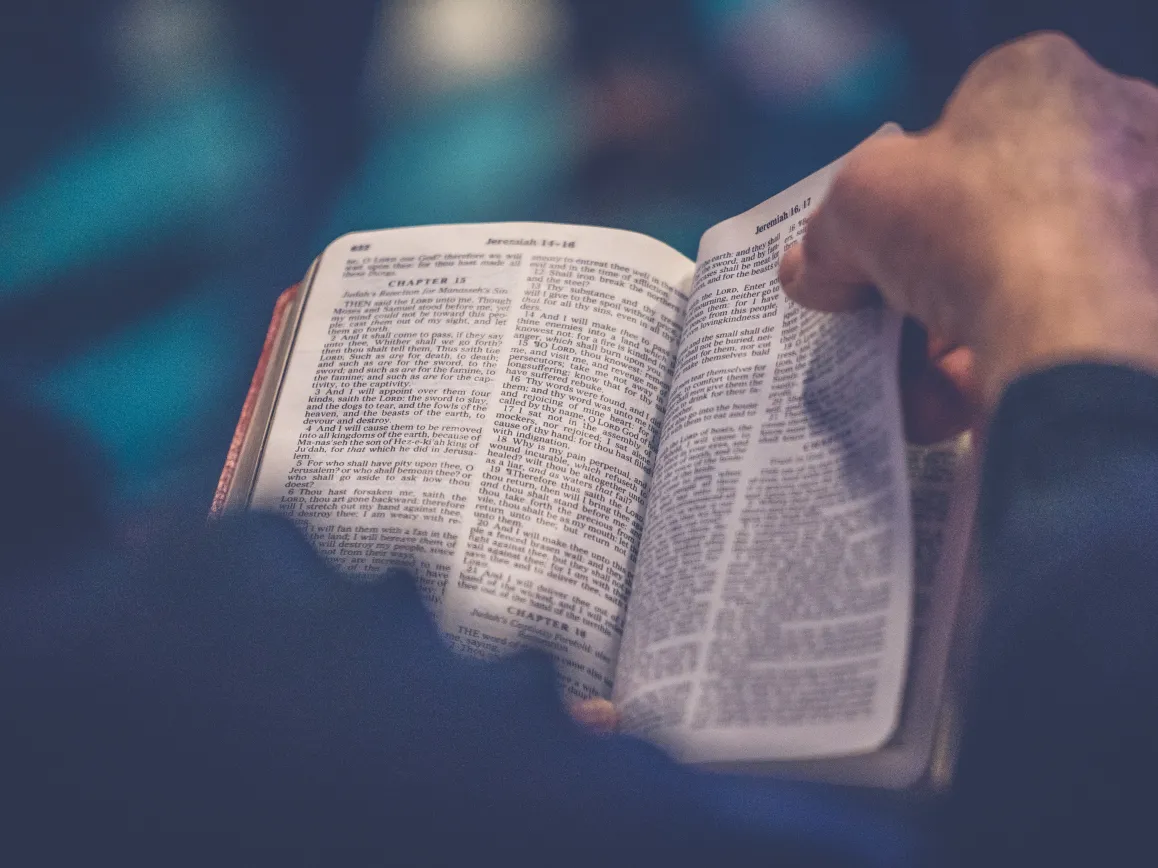
Neugierig auf das Christentum?
Menschen fragen nach Gott, sie wollen ihren Glauben besser verstehen oder über den Sinn des Lebens nachdenken. Der Evangelische Theologiekurs ist das kirchliche Angebot einer Langzeitfortbildung für Erwachsene, die sie dabei umfassend unterstützt und begleitet.

